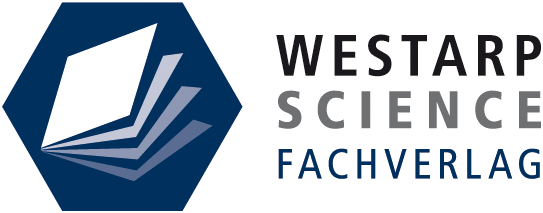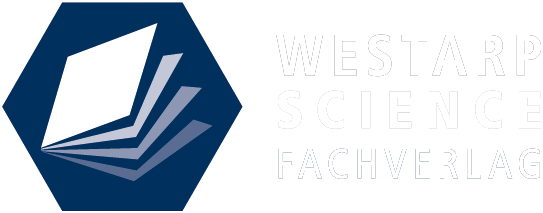Bildung neu gedacht
Wir alle kennen sie: Momente, in denen unser bisheriges Weltbild ins Wanken gerät. Ob durch persönliche Schicksalsschläge, gesellschaftliche Umbrüche oder existenzielle Fragen – Krisen gehören zum Leben. Doch was, wenn diese Krisen nicht nur Hindernisse, sondern auch Chancen wären? Der Religionspädagoge und Theologe Marcin Morawski hat sich in seinem Fachartikel im Handbuch der Religionen intensiv mit der Frage beschäftigt, welche Rolle Krisen in Bildungsprozessen spielen – insbesondere im Bereich der Religionspädagogik. In seinem Beitrag „Von der Krise zur Transformation?“ stellt er die Theorie der transformatorischen Bildung vor und zeigt, warum Krisen nicht nur bedrohlich, sondern auch heilsam und bildend sein können. Dieser Blogbeitrag fasst die wesentlichen Punkte seines Artikels zusammen.
Was ist transformatorische Bildung?
Transformatorische Bildung ist mehr als das bloße Anhäufen von Wissen oder das Erlernen von Fähigkeiten. Sie zielt darauf ab, unser Selbst-, Welt-, Fremd- und Gottesverhältnis zu verändern. Das klingt abstrakt, ist aber im Kern sehr praktisch: Es geht darum, wie wir uns selbst, andere Menschen, die Welt um uns herum und – für viele – auch das Göttliche verstehen und gestalten.
Die Idee stammt von Bildungstheoretikern wie Winfried Marotzki, Hans-Christoph Koller und Helmut Peukert. Sie betonen, dass echte Bildung dann stattfindet, wenn wir durch Krisen oder herausfordernde Erfahrungen unsere bisherigen Denkmuster hinterfragen und neue Perspektiven entwickeln. Das kann bedeuten, dass wir uns von alten Überzeugungen lösen, neue Werte entdecken oder sogar unser gesamtes Leben neu ausrichten.
Krisen: Bedrohung oder Chance?
Krisen sind oft schmerzhaft. Sie können uns das Gefühl geben, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Doch genau in diesen Momenten liegt auch eine Chance. Morawski beschreibt Krisen als „subsumptionsresistente Erfahrungen“ – also als Erlebnisse, die sich nicht einfach in unsere bisherigen Denkmuster einordnen lassen. Das kann beunruhigend sein, aber auch befreiend: Denn wenn alte Muster nicht mehr funktionieren, sind wir gezwungen, Neues zu wagen.
Ein Beispiel: Wer seinen Job verliert, steht zunächst vor einer existenziellen Krise. Doch diese Erfahrung kann auch dazu führen, dass man sich fragt: „Was will ich wirklich?“ und neue Wege einschlägt – sei es durch eine berufliche Neuorientierung oder die Entdeckung bisher vernachlässigter Lebensbereiche.
Bildung als „Andersdenken und Anderswerden“
Transformatorische Bildung ist kein passiver Prozess. Sie erfordert Aktivität und Mut. Es geht nicht darum, sich an bestehende Verhältnisse anzupassen, sondern darum, diese zu hinterfragen und gegebenenfalls zu verändern. Koller spricht von Bildung als einem „Andersdenken und Anderswerden“.
Das bedeutet:
- Freiheit statt Anpassung: Statt uns den Erwartungen von Gesellschaft oder Wirtschaft zu unterwerfen, geht es darum, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
- Tiefe statt Oberflächlichkeit: Echte Bildung verändert nicht nur unser Wissen, sondern auch unsere Haltung – zu uns selbst, zu anderen und zur Welt.
- Solidarität und Verantwortung: Besonders in religiösen Kontexten betont Peukert, dass Bildung auch bedeutet, Verantwortung für andere und für die Zukunft zu übernehmen.
Religiöse Bildung: Transformation durch Glaube
Für viele Menschen spielt der Glaube eine zentrale Rolle in transformatorischen Prozessen. Morawski zeigt, wie religiöse Bildung – etwa im Religionsunterricht oder in persönlichen Glaubenserfahrungen – Krisen in Chancen verwandeln kann.
- Bekehrung als Wandel: Denken wir an Figuren wie Paulus oder Augustinus, deren Leben durch religiöse Erfahrungen radikal verändert wurden. Solche „Umkehr“-Erlebnisse sind Beispiele für transformatorische Bildung.
- Fremdheit als Lerngelegenheit: Im Umgang mit dem „Fremden“ – sei es in anderen Kulturen, Religionen oder Weltanschauungen – können wir unsere eigenen Perspektiven erweitern. Bernhard Grümme spricht von einer „asymmetrischen Dialogizität“: Es geht nicht darum, das Fremde einfach zu „verstehen“ oder einzupassen, sondern es als Herausforderung zu begreifen, die uns weiterbringt.
- Krisen als didaktisches Mittel: Im Religionsunterricht können gezielt Themen behandelt werden, die Schüler:innen herausfordern – etwa durch die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen oder anderen Glaubensrichtungen. Das Ziel ist nicht, einfache Antworten zu geben, sondern Raum für neue Fragen und Perspektiven zu schaffen.
Geisteskultur: Warum Literatur, Kunst und Philosophie uns bereichern
Morawski betont, dass Geisteskultur – also Literatur, Philosophie, Kunst und religiöse Texte – eine wichtige Rolle in transformatorischen Bildungsprozessen spielt. Warum? Weil sie uns helfen, unsere eigenen Grenzen zu überschreiten.
- Transzendenz des Alltags: Werke der Hochkultur (z. B. Goethes „Faust“, buddhistische Weisheitstexte oder die Bibel) ermöglichen es uns, über unseren eigenen Tellerrand hinauszublicken. Sie stellen universelle Fragen, die uns auch heute noch bewegen.
- Krisenbewältigung durch Kultur: In Morawskis Studie mit polnischstämmigen Religionslehrer:innen zeigte sich, dass gerade die Auseinandersetzung mit literarischen oder philosophischen Texten half, persönliche Krisen zu überwinden und neue Lebensperspektiven zu entwickeln.
Praktische Impulse: Wie können wir transformatorische Bildung leben?
Wie lässt sich dieser Ansatz im Alltag umsetzen? Hier ein paar Anregungen:
- Krisen als Lerngelegenheiten begreifen:
- Statt Krisen zu verdrängen, können wir uns fragen: „Was kann ich aus dieser Erfahrung lernen?“ oder „Wie könnte ich mein Leben dadurch bereichern?“
- Ein Tagebuch kann helfen, solche Prozesse zu reflektieren.
- Fremdes zulassen:
- Ob im Gespräch mit Menschen anderer Kulturen, beim Lesen unbekannter Literatur oder beim Kennenlernen neuer spiritueller Praktiken – das Fremde kann uns bereichern, wenn wir uns darauf einlassen.
- Bildung als lebenslangen Prozess verstehen:
- Transformatorische Bildung endet nicht mit der Schule. Sie findet im gesamten Leben statt – durch Begegnungen, Bücher, Reisen oder auch durch stille Momente der Reflexion.
- Religiöse und spirituelle Impulse nutzen:
- Für gläubige Menschen können Gebet, Meditation oder der Austausch in Gemeinschaften Räume bieten, um Krisen zu verarbeiten und neue Wege zu finden.
Fazit: Bildung, die das Leben verändert
Marcin Morawskis Artikel erinnert uns daran, dass echte Bildung mehr ist als das Sammeln von Zertifikaten oder das Erlernen von Fähigkeiten. Sie ist ein Prozess der Transformation – ein Weg, auf dem wir uns selbst, unsere Beziehungen und unsere Welt immer wieder neu entdecken.
In einer Zeit, die oft von Unsicherheit und schnellem Wandel geprägt ist, bietet der Ansatz der transformatorischen Bildung eine wertvolle Perspektive: Krisen müssen nicht das Ende sein. Sie können der Anfang von etwas Neuem werden. Ob durch persönliche Reflexion, den Dialog mit anderen oder die Auseinandersetzung mit Kultur und Spiritualität – wir alle haben die Chance, unser Leben bewusst zu gestalten und durch Krisen zu wachsen.
Das Handbuch der Religionen in Ihrer Bibliothek
Das Handbuch der Religionen steht Ihnen in zahlreichen Bibliotheken online zur Verfügung. Sollte es in Ihrer Bibliothek noch nicht verfügbar sein, regen Sie dort doch einfach die Beschaffung des Werkes an.