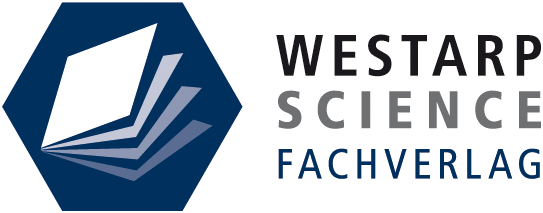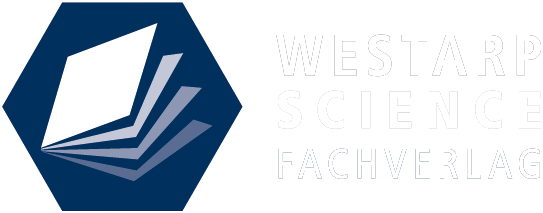In einer Zeit, in der die ökologischen Krisen unserer Erde immer drängender werden, stellt sich die Frage: Wie können wir als Menschen unsere Verantwortung gegenüber der Schöpfung neu denken? Der Fachartikel „Vom Schrei der Kreatur – Mit-Leidenschaft und Mit-Geschöpflichkeit als Impulse für eine religionspädagogische Nachhaltigkeitsethik“ von Dr. Maike Maria Domsel bietet hierzu tiefgründige Antworten. Domsel verbindet die Konzepte der Compassion (Johann Baptist Metz) und der Ehrfurcht vor dem Leben (Albert Schweitzer) zu einer integrativen Ethik, die nicht nur den Menschen, sondern alle Lebewesen in den Mittelpunkt stellt. Dieser Blogbeitrag fasst die zentralen Gedanken des Artikels zusammen und zeigt auf, wie wir durch Mitgefühl und Achtsamkeit eine Kultur der Verantwortung und Solidarität mit der gesamten Schöpfung gestalten können.
Warum wir eine neue Ethik brauchen: Der Ruf der Erde
Die Welt steht vor immensen Herausforderungen: Klimawandel, Artensterben, soziale Ungerechtigkeit. Doch wie können wir diesen Krisen begegnen? Domsel argumentiert, dass wir eine Ethik brauchen, die über den anthropozentrischen Blick hinausgeht – eine Ethik, die nicht nur den Menschen, sondern alle Lebewesen als gleichwertig anerkennt. Die christliche Tradition bietet hier ambivalente Ansätze: Einerseits betont sie die Bewahrung der Schöpfung (Gen 2,15), andererseits hat sie oft eine Hierarchie geschaffen, in der der Mensch über der Natur steht. Doch gerade heute, wo die Folgen dieser Haltung sichtbar werden, ist es Zeit, unser Verhältnis zur Mitwelt neu zu definieren.
Die Autorin plädiert dafür, das Konzept der Mitgeschöpflichkeit in den Vordergrund zu stellen: Wir sind nicht die Herren der Schöpfung, sondern ein Teil von ihr. Diese Erkenntnis ist nicht nur theologisch, sondern auch praktisch relevant. Sie fordert uns auf, unser Handeln zu hinterfragen und eine Haltung der Solidarität mit allem Lebendigen zu entwickeln.
Compassion: Mit-Leiden als ethische Grundhaltung
Johann Baptist Metz prägte den Begriff der Compassion – ein Mit-Leiden, das uns dazu bewegt, das Leid der anderen nicht nur zu sehen, sondern aktiv zu lindern. Compassion ist mehr als Mitleid; sie ist eine radikale Teilhabe am Schicksal der Schwachen und Ausgegrenzten. Metz versteht sie als eine politische und spirituelle Haltung, die uns „an die Front der sozialen und kulturellen Konflikte“ führt. Compassion bedeutet, das Leid der Welt nicht zu ignorieren, sondern es als Aufruf zum Handeln zu verstehen.
Doch wie lässt sich diese Haltung auf die gesamte Schöpfung ausweiten? Domsel zeigt, dass Compassion nicht nur zwischen Menschen, sondern auch gegenüber Tieren und der Natur gelebt werden kann. Wenn wir den „Schrei der Kreatur“ hören – das Leid der Tiere in Massentierhaltung, die Zerstörung von Lebensräumen –, sind wir aufgerufen, Verantwortung zu übernehmen.
Ehrfurcht vor dem Leben: Albert Schweitzers universale Ethik
Albert Schweitzer ging noch einen Schritt weiter. Seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben erkennt jeden Lebenswillen als schützenswert an – ob Mensch, Tier oder Pflanze. Schweitzer, selbst Theologe, Arzt und Musiker, lebte diese Haltung vor, etwa in seinem Engagement als Arzt in Lambaréné (Gabun). Für ihn war klar: „Ethik ist ins Grenzenlose erweiterte Verantwortung gegen alles, was lebt.“
Seine Ethik ist keine abstrakte Theorie, sondern eine praktische Haltung. Sie fordert uns auf, unsere Gewohnheiten zu hinterfragen: Wie behandeln wir Tiere? Wie gehen wir mit der Natur um? Schweitzer sah im Tierschutz sogar eine „Arbeit am Reich Gottes“. Seine Botschaft ist heute aktueller denn je: Jedes Lebewesen hat einen intrinsischen Wert, unabhängig von seinem Nutzen für den Menschen.
Wie können wir Mitgeschöpflichkeit leben?
Domsel zeigt konkrete Wege auf, wie diese Ethik in der Bildung und im Alltag umgesetzt werden kann:
- Tiergestützte Pädagogik: Lernen durch Begegnung
Tiere sind nicht nur Objekte, sondern lebendige Wesen, die uns lehren können, Verantwortung zu übernehmen. In Schulen und Bildungsstätten können Begegnungen mit Tieren – etwa durch tiergestützte Projekte – Empathie und Respekt fördern. Kinder lernen, dass Tiere nicht nur „Nutztiere“ sind, sondern Mitgeschöpfe mit eigenen Bedürfnissen.
- Ökologische Projekte: Handeln statt Reden
Gemeinschaftsgärten, Permakultur oder Schulprojekte zur Nachhaltigkeit machen Mitgeschöpflichkeit erlebbar. Wer selbst sät, erntet und die Kreisläufe der Natur begreift, entwickelt ein neues Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge.
- Systemisches Denken: Globale Verantwortung
Die Krisen unserer Zeit sind verflochten: Armut, Umweltzerstörung und Tierleid hängen zusammen. Eine Ethik der Mitgeschöpflichkeit fordert uns auf, diese Zusammenhänge zu erkennen und lokal wie global zu handeln – sei es durch fairen Konsum, Engagement für Tierrechte oder Klimaschutz.
- Kunst und Spiritualität: Kreativer Ausdruck von Verantwortung
Kunstprojekte, die sich mit ökologischen Themen beschäftigen, können eine Brücke zwischen Verstand und Gefühl schlagen. Sie helfen uns, unsere Verbundenheit mit der Schöpfung ästhetisch zu erleben und zu reflektieren.
Fazit: Eine Einladung zur Veränderung
Domsel schließt mit einer Vision: Eine Welt, in der wir den „Schrei der Kreatur“ nicht überhören, sondern als Ruf zur Umkehr verstehen. Eine Ethik der Mit-Leidenschaft und Mit-Geschöpflichkeit ist kein abstraktes Ideal, sondern eine Einladung, unser Leben neu auszurichten. Sie beginnt im Kleinen – im bewussten Umgang mit Tieren, in der Achtsamkeit gegenüber der Natur, im Engagement für Gerechtigkeit.
Der Artikel von Maike Maria Domsel ist nicht nur eine theologische Reflexion, sondern ein Aufruf zum Handeln. Er erinnert uns daran, dass wir nicht allein auf dieser Erde sind, sondern Teil eines großen Ganzen. Und dass es an uns liegt, diese Welt so zu gestalten, dass alle Lebewesen in Würde leben können.
Das Handbuch der Religionen in Ihrer Bibliothek
Das Handbuch der Religionen steht Ihnen in zahlreichen Bibliotheken online zur Verfügung. Sollte es in Ihrer Bibliothek noch nicht verfügbar sein, regen Sie dort doch einfach die Beschaffung des Werkes an.