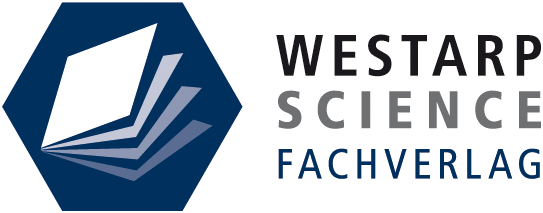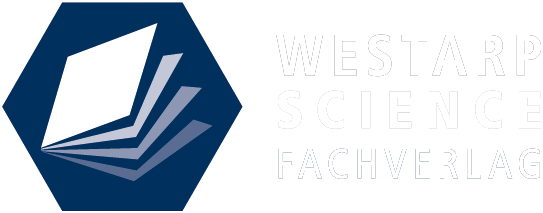Wie Sinnsuche den Unterricht bereichern kann
In einer Zeit, in der traditionelle Religionszugehörigkeiten abnehmen und immer mehr Menschen sich als „spirituell, aber nicht religiös“ beschreiben, stellt sich die Frage: Sollte Spiritualität einen festen Platz in unseren Schulen finden? Der Theologe und Religionspädagoge Patrik C. Höring hat sich in seinem Fachartikel „Spiritualität als Schulfach? Bildungstheoretische und theologische Aspekte“ intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Seine Analyse zeigt: Spiritualität ist nicht nur ein privates Anliegen, sondern könnte eine Brücke bauen – zwischen individueller Sinnsuche, religiöser Vielfalt und schulischer Bildung. Doch was bedeutet Spiritualität überhaupt? Und wie lässt sie sich im Schulalltag verankern, ohne in Esoterik oder konfessionelle Enge abzurutschen? Dieser Blogbeitrag fasst die zentralen Gedanken Hörings zusammen und lädt dazu ein, über die Chancen und Herausforderungen spirituellen Lernens nachzudenken.
Spiritualität vs. Religion: Warum der Unterschied wichtig ist
„Ich bin spirituell, aber nicht religiös“ – dieser Satz fällt heute oft, wenn es um Glauben und Sinn geht. Doch was steckt dahinter? Höring zeigt auf, dass Spiritualität und Religiosität zwar verwandt, aber nicht identisch sind:
- Religiosität ist meist an Institutionen, Dogmen und Rituale gebunden – also an Kirchen, Moscheen oder Synagogen.
- Spiritualität hingegen ist offener, individueller und erfahrungsbasiert. Sie kann sich in Meditation, Naturverbundenheit, Kunst oder einfach im Staunen über das Leben äußern.
Warum das für Schulen relevant ist:
In einer pluralen Gesellschaft, in der viele Menschen keine Bindung an eine Religion mehr haben, bietet Spiritualität einen „kleinsten gemeinsamen Nenner“. Sie spricht auch die an, die sich als atheistisch oder konfessionsfrei verstehen – solange sie Raum für Fragen nach Sinn, Verbundenheit und Transzendenz lässt.
Spiritualität im Schulalltag: Was sagt die Praxis?
Deutschland und Österreich: Konfessioneller Unterricht mit spirituellen Ansätzen
In Deutschland und Österreich ist der Religionsunterricht traditionell konfessionell geprägt. Doch selbst hier gibt es Ansätze, Spiritualität als Lernziel zu integrieren:
- Lehrpläne in Österreich betonen etwa, dass Religionsunterricht „zur Entdeckung und Förderung der persönlichen Religiosität und Spiritualität“ beitragen soll.
- In Bayern können Gottesdienste in begrenztem Umfang Teil des Unterrichts sein.
- In Nordrhein-Westfalen wird die „Ehrfurcht vor Gott“ als Bildungsziel genannt – doch konkrete spirituelle Praxis bleibt oft der Schulpastoral oder freiwilligen Angeboten vorbehalten.
Das Problem: Solange Spiritualität nur im konfessionellen Rahmen thematisiert wird, erreichen wir damit nicht alle Schüler:innen. Wer keiner Kirche angehört, bleibt außen vor.
England und Wales: Spiritualität als Querschnittsthema
Hier geht man einen anderen Weg: Seit den 1980er-Jahren ist die „geistige, moralische, soziale und kulturelle Entwicklung“ (SMSC) der Schüler:innen gesetzlich verankert. Spiritualität wird dabei als allgemeinmenschliche Kompetenz verstanden, die in allen Fächern gefördert werden soll – nicht nur im Religionsunterricht.
Was bedeutet das konkret?
Schulen sollen Räume schaffen für:
- Staunen und Ehrfurcht (z. B. durch Naturerlebnisse oder Kunst),
- Sinnfragen („Warum lebe ich? Was gibt mir Halt?“),
- Beziehungsfähigkeit (Empathie, Gemeinschaftserlebnisse),
- Kreativität (z. B. durch Musik, Schreiben, Theater).
Das Besondere: Spiritualität wird nicht als „Religion light“ verstanden, sondern als Teil der Persönlichkeitsentwicklung – unabhängig von religiöser Zugehörigkeit.
Spiritualität lernen: Geht das überhaupt?
Kritiker:innen fragen: Kann man Spiritualität „unterrichten“ wie Mathematik oder Geschichte? Höring betont: Es geht nicht um Wissensvermittlung, sondern um Erfahrung und Reflexion.
Wie könnte spirituelles Lernen aussehen?
- Perzeption (Wahrnehmung):
- Achtsamkeitsübungen, Stillephasen, Naturbeobachtungen.
- Beispiel: Eine Schulklasse besucht einen Wald und reflektiert: „Wo erlebe ich Verbundenheit?“
- Performanz (Handeln):
- Spirituelle Praktiken ausprobieren: Meditation, Gebet (auch nicht-religiös), kreative Ausdrucksformen.
- Beispiel: Ein Projekt zu „Dankbarkeit“ – mit Tagebüchern, Collagen oder Gesprächen.
- Partizipation (Teilhabe):
- Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen.
- Beispiel: Ein Besuch in einer Moschee, Synagoge oder einem Meditationszentrum – mit anschließendem Austausch.
Wichtig: Es geht nicht darum, Schüler:innen zu „bekehren“, sondern ihnen Werkzeuge für die eigene Sinnsuche an die Hand zu geben.
Chancen und Herausforderungen: Warum Spiritualität in der Schule polarisiert
Die Chancen:
- Inklusion: Spiritualität kann alle ansprechen – ob gläubig, suchend oder skeptisch.
- Resilienz: Studien zeigen, dass spirituelle Praxis (z. B. Meditation) Stress reduziert und das Wohlbefinden steigert.
- Wertebildung: Themen wie Mitgefühl, Verantwortung und Achtsamkeit werden erlebbar.
Die Herausforderungen:
- Neutralität: Wie vermeidet man es, Spiritualität zur „Esoterik-Stunde“ oder versteckten Missionierung werden zu lassen?
- Zeit und Raum: Schulen sind oft auf Leistung und Effizienz ausgelegt – wo bleibt da Platz für Stille und Reflexion?
- Qualifikation: Lehrkräfte brauchen Fortbildungen, um spirituelle Prozesse sensibel zu begleiten.
Hörings Fazit: Spiritualität in der Schule ist kein Allheilmittel, aber eine Chance für ein ganzheitliches Lernen, das Kopf, Herz und Hand verbindet.
Ein Plädoyer für mehr Mut: Spiritualität als Teil moderner Bildung
Patrik C. Hörings Artikel zeigt: Spiritualität ist kein Relikt aus vergangenen Zeiten, sondern eine Antwort auf aktuelle Herausforderungen. In einer Welt, die von Leistungsdruck, Digitalisierung und Sinnkrisen geprägt ist, sehnen sich viele Menschen – besonders junge – nach Verbundenheit, Orientierung und innerer Ruhe.
Schulen könnten hier eine Schlüsselrolle einnehmen:
- Als Ort der Begegnung, an dem unterschiedliche spirituelle Wege sichtbar werden.
- Als Labor für Lebensfragen, in dem Schüler:innen lernen, mit Zweifeln, Hoffnung und Transzendenz umzugehen.
- Als Gegenentwurf zur Vereinzelung, indem Gemeinschaftserfahrungen und Rituale (auch säkulare!) Raum bekommen.
Drei konkrete Schritte für Schulen:
- Pilotprojekte starten: B. eine „Woche der Achtsamkeit“ mit Workshops zu Meditation, Naturerlebnis und kreativem Schreiben.
- Lehrkräfte fortbilden: Wie kann ich spirituelle Impulse im Fachunterricht (z. B. Ethik, Kunst, Biologie) einbauen?
- Kooperationen suchen: Mit Kirchen, Moscheen, Meditationszentren oder Umweltinitiativen, um vielfältige Perspektiven einzubeziehen.
Fazit: Spiritualität ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit
Hörings Artikel endet mit einem Zitat aus dem 1. Korintherbrief: „Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen – doch Gott lässt wachsen.“ Das gilt auch für spirituelles Lernen: Schulen können Räume öffnen, Anstöße geben – aber die eigentliche „Arbeit“ geschieht im Inneren jedes Einzelnen.
In einer Zeit, in der viele Menschen nach Halt suchen, wäre es ein Verzicht, Spiritualität aus der Schule auszuklammern. Es geht nicht darum, eine neue „Pflichtveranstaltung“ einzuführen, sondern darum, das Menschliche im Lernen nicht zu vergessen.
Das Handbuch der Religionen in Ihrer Bibliothek
Das Handbuch der Religionen steht Ihnen in zahlreichen Bibliotheken online zur Verfügung. Sollte es in Ihrer Bibliothek noch nicht verfügbar sein, regen Sie dort doch einfach die Beschaffung des Werkes an.