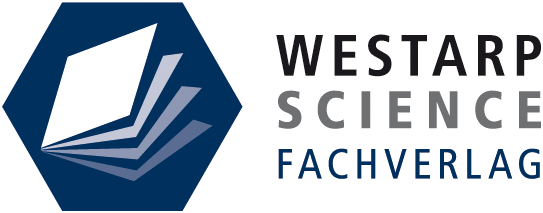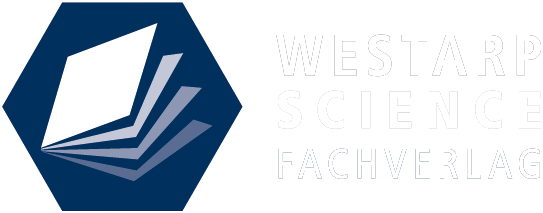Wie die Kirche ihre Wunden heilen und neu denken kann
Die Kirche steht heute vor einer tiefgreifenden Krise. Immer weniger Menschen – ob Gläubige, Lehrkräfte oder Schüler:innen – identifizieren sich mit ihr. Gleichzeitig ringt sie mit ihrer eigenen Geschichte: mit Machtmissbrauch, Ausschluss und dem Schweigen über unbequeme Wahrheiten. Doch was, wenn gerade diese Brüche und Wunden der Schlüssel zu einer neuen, authentischen Kirchlichkeit wären? Sigrid Rettenbacher, Theologin und Religionspädagogin, wirft in ihrem aktuellen Artikel im Handbuch der Religionen einen mutigen Blick auf die „verwundende und verwundete Kirche“ – und zeigt, wie ein ehrlicher Umgang mit den eigenen Fehlern nicht nur Befreiung, sondern auch neue Hoffnung bringen kann. In diesem Blogbeitrag fassen wir ihre zentralen Gedanken zusammen: Wie post-/dekoloniale Perspektiven helfen, die Kirche neu zu verstehen – und warum gerade die Risse in ihren Mauern Raum für Licht und Veränderung schaffen.
Die Kirche als verwundeter Leib: Warum wir über die eigenen Narben sprechen müssen
„Der Auferstandene trägt die Wunden des Gekreuzigten.“ Dieses Bild ist zentral im Christentum. Doch während die Kirche oft von den Wunden der Welt spricht – Armut, Krieg, Ungerechtigkeit –, verdrängt sie häufig ihre eigenen: die Wunden, die sie anderen und sich selbst zugefügt hat. Ob durch kolonialistische Mission, die Unterdrückung von Frauen, die Ausgrenzung von LGBTQ+-Personen oder den Umgang mit Machtmissbrauch – die Kirche hat nicht nur geheilt, sondern auch verletzt.
Rettenbacher betont: „Eine Kirche, die ihre eigenen Brüche leugnet, kann keine glaubwürdige Botschaft der Hoffnung verkünden.“ Papst Franziskus sprach einmal von einer „verbeulten Kirche“, die ihm lieber ist als eine makellose, aber abgehobene Institution. Doch wie lässt sich diese Haltung leben? Indem wir die „active ignorance“ – das bewusste Wegschauen, Verdrängen und Vergessen – überwinden. Denn nur wer die eigenen Wunden benennt, kann sie heilen.
Post-/dekoloniale Perspektiven: Warum die Kirche ihre Geschichte neu lesen muss
Kolonialismus und Kirche sind untrennbar miteinander verwoben. Missionare brachten nicht nur den Glauben, sondern oft auch Unterdrückung, kulturelle Entwurzelung und die Abwertung anderer Religionen. Post-/dekoloniale Theorien zeigen: Viele unserer heutigen Machtstrukturen – in Kirche und Gesellschaft – sind Erbe dieser Zeit.
- Wer darf sprechen? In der Kirche haben lange weiße, männliche, westliche Stimmen die Deutungshoheit gehabt. Andere Perspektiven – etwa von Frauen, indigenen Gemeinschaften oder queeren Menschen – wurden marginalisiert oder ganz zum Schweigen gebracht.
- Was wird verschwiegen? Die Kirche hat oft „unbequeme“ Themen ausgeblendet: ihre Rolle im Sklavenhandel, die Vertreibung indigener Kulturen, die Pathologisierung von Homosexualität. Dieses Schweigen ist kein Zufall, sondern Teil einer Machtstrategie.
- Wie wirkt Kolonialität heute? Selbst wenn wir uns als „fortschrittlich“ sehen: Viele unserer Denkweisen – etwa die Vorstellung, dass „der Westen“ die Norm setzt – sind kolonial geprägt. Das betrifft auch den Religionsunterricht, wo oft unreflektiert „europäische“ Interpretationen des Christentums vermittelt werden.
Rettenbacher plädiert dafür, diese „blinden Flecken“ bewusst zu machen. Denn nur wer die eigene Geschichte kritisch betrachtet, kann neue, befreiende Narrative entwickeln – und Raum für Stimmen schaffen, die lange ignoriert wurden.
Religionsunterricht im Spannungsfeld: Zwischen Kirchlichkeit und Kritik
Der Religionsunterricht steht vor einem Dilemma: Einerseits soll er „kirchlich“ sein – also die Lehren der Kirche vermitteln. Andererseits erleben viele Lehrkräfte und Schüler:innen eine wachsende Distanz zur Institution Kirche. Eine aktuelle Studie zeigt:
- 80 % der Religionslehrkräfte geben an, dass ihre Identifikation mit der Kirche in den letzten Jahren abgenommen hat.
- Fast 90 % sehen eine große Kluft zwischen ihren persönlichen Überzeugungen und den offiziellen kirchlichen Positionen – etwa zu Sexualität, Gender oder Machtstrukturen.
Wie kann Religionsunterricht trotzdem glaubwürdig sein? Rettenbacher schlägt vor:
- Kritische Reflexion statt unkritischer Weitergabe: Statt kirchliche Lehren einfach zu wiederholen, sollten Schüler:innen lernen, Fragen zu stellen – auch unbequeme. Warum wurden bestimmte Gruppen ausgeschlossen? Welche Alternativen gibt es zu den „offiziellen“ Narrativen?
- Multiperspektivität: Der Unterricht sollte vielfältige Stimmen einbeziehen – etwa von Theolog:innen aus dem globalen Süden, von Frauen oder von Menschen, die von der Kirche verletzt wurden.
- Ehrlichkeit über Brüche: Statt die Kirche als „perfekt“ darzustellen, könnte der Unterricht zeigen: Gerade die Risse machen sie menschlich – und damit nahbar.
„There is a crack in everything“: Warum Brüche Hoffnung machen
Der Titel des Artikels von Sigrid Rettenbacher ist ein Zitat aus Leonard Cohens „Anthem“: „There is a crack in everything, that’s how the light gets in.“ Rettenbacher deutet es theologisch: Die Brüche der Kirche sind kein Zeichen des Scheiterns, sondern die Orte, an denen Gott neu wirken kann.
- Licht durch Risse: Wenn die Kirche ihre Wunden nicht mehr verdeckt, sondern sie als Teil ihrer Identität annimmt, wird sie authentischer – und damit attraktiver für Menschen, die nach Ehrlichkeit suchen.
- Neue Wege der Identifikation: Viele junge Menschen wenden sich nicht vom Glauben ab, sondern von einer hypokritischen Institution. Ein offener Umgang mit Fehlern könnte ihnen helfen, sich trotzdem mit dem Christentum verbunden zu fühlen.
- Theologie der Frag-würdigkeit: Statt sich als „Identitätsgarant“ zu inszenieren, sollte die Kirche sich selbst infrage stellen – im besten Sinne. Denn nur wer fragt, kann wachsen.
Praktische Schritte: Wie kann Veränderung gelingen?
Rettenbachers Analyse ist kein Appell zur Resignation, sondern zur kreativen Neugestaltung. Einige konkrete Ansätze:
Für die Kirche:
- Aktive Erinnerungskultur: Die Kirche sollte ihre Schuldgeschichte systematisch aufarbeiten – nicht als einmalige Geste, sondern als dauerhaften Prozess. Beispiele wie die „Bußvigil“ der Weltsynode 2024 sind ein Anfang.
- Macht teilen: Statt hierarchische Strukturen zu zementieren, könnte die Kirche mehr Partizipation wagen – etwa durch synodale Prozesse, in denen auch Laien, Frauen und Marginalisierte mitentscheiden.
- Theologie des „Ungesagten“: Viele Themen – wie Sexualität oder Gender – werden in der Kirche tabuisiert. Ein offener Diskurs wäre ein Zeichen von Stärke, nicht von Schwäche.
Für den Religionsunterricht:
- Kritische Lehrbücher: Statt veraltete, eurozentrische Darstellungen zu wiederholen, sollten Materialien postkoloniale Perspektiven einbeziehen – etwa indem sie fragen: Wer wird in diesem Text repräsentiert? Wer fehlt?
- Projektarbeit zu kirchlicher Geschichte: Schüler:innen könnten etwa recherchieren, wie die Kirche in der Kolonialzeit agierte – und alternative Erzählungen entwickeln.
- Raum für Zweifel: Der Unterricht sollte Fragen erlauben – auch solche, die die Kirche selbst betreffen. Denn Glaube lebt nicht von blindem Gehorsam, sondern von ehrlicher Suche.
Für jede:n Einzelne:n:
- Hinschauen statt wegsehen: Wenn wir in unserer Gemeinde oder Gemeinde Strukturen erkennen, die Menschen ausschließen, können wir darauf aufmerksam machen – behutsam, aber bestimmt.
- Zuhören lernen: Besonders den Stimmen, die in der Kirche selten gehört werden – etwa von Frauen, Queers oder Menschen mit Migrationshintergrund.
- Mut zur Parrhesia: Das griechische Wort bedeutet „Freimut“ – also die Bereitschaft, Unbequemes auszusprechen, auch wenn es Konflikte gibt. Eine Tugend, die die frühe Kirche kannte – und die heute wieder gebraucht wird.
Fazit: Eine Kirche, die atmet
Sigrid Rettenbachers Artikel ist kein Angriff auf die Kirche, sondern ein Aufruf zur Heilung. Eine Kirche, die ihre Risse anerkennt, wird nicht schwächer – im Gegenteil: Sie wird durchlässig für das Licht, das durch die Brüche fällt. Das gilt für die Institution, für den Religionsunterricht und für jede:n Einzelne:n, die oder der sich mit dem Christentum verbunden fühlt.
Vielleicht ist es gerade die Verwundbarkeit, die die Kirche heute braucht: nicht als Zeichen des Niedergangs, sondern als Chance für einen neuen Anfang. Ein Anfang, der nicht auf Macht, sondern auf Demut baut. Nicht auf Schweigen, sondern auf Dialog. Nicht auf Ausgrenzung, sondern auf radikale Inklusion.
Denn am Ende geht es nicht darum, eine perfekte Kirche zu sein – sondern eine, die atmet. Eine, die lernt. Eine, die Licht durchlässt.
Das Handbuch der Religionen in Ihrer Bibliothek
Das Handbuch der Religionen steht Ihnen in zahlreichen Bibliotheken online zur Verfügung. Sollte es in Ihrer Bibliothek noch nicht verfügbar sein, regen Sie dort doch einfach die Beschaffung des Werkes an.