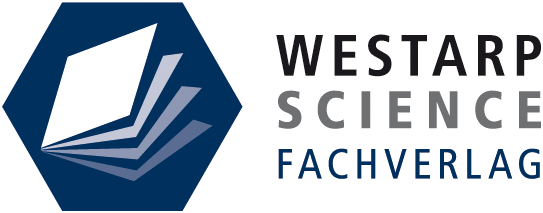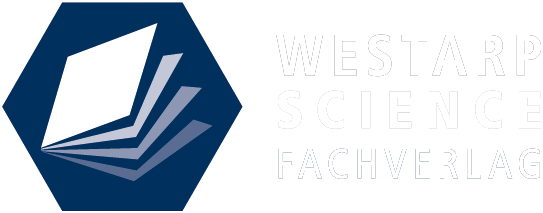Ergänzungslieferung 86
Mit der EL 86 legen wir eine weitere monothematische Ergänzungslieferung vor. Sie thematisiert „Religionswissenschaftliche Geschlechterforschung: Perspektiven auf Fachgeschichte, Theorien, Geschlechterordnungen, Sexualität und Körper“.
Wir danken unserer Fachherausgeberin Frau Verena Maske, M.A. (Doktorandin am Fach Religionswissenschaft der Philipps-Universität Marburg) und ihren Kolleginnen Frau Prof. Dr. phil. habil. Doris Decker (Assistenzprofessorin für Historische und Vergleichende Religionswissenschaft, Universität Zürich) und Frau Marita Günther, M.A. (Doktorandin am Fach Religionswissenschaft der Philipps-Universität Marburg) für die konzeptionelle Entwicklung und herausgeberische Betreuung dieser Ergänzungslieferung, der wir eine große Aufmerksamkeit wünschen.
Die HdR-Herausgeber
Sehr geehrte Leser*innen,
die vorliegende Ergänzungslieferung „Religionswissenschaftliche Geschlechterforschung: Perspektiven auf Fachgeschichte, Theorien, Geschlechterordnungen, Sexualität und Körper“ gibt einen Einblick in ausgewählte aktuelle Forschung der religionswissenschaftlichen Geschlechterforschung, die in unterschiedlicher Gewichtung Perspektiven auf die Fachgeschichte, Theorien, Geschlechterordnungen, Sexualität und Körper eröffnen und diese miteinander verschränken. Damit wird eine Forschungsrichtung in den Fokus gerückt, die in den letzten Jahrzehnten nicht nur in der Religionswissenschaft, sondern auch in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften zunehmend an Bedeutung gewonnen und maßgebliche Impulse gesetzt hat, nämlich genderbezogene Forschung. Eines ihrer zentralen Erkenntnisinteressen liegt in der Analyse von Macht- und Wissensordnungen, die über Geschlechterkonzeptionen, Körperbilder und Sexualitätsnormen vermittelt werden – und die durch religiöse Traditionen hergestellt, stabilisiert, legitimiert, aber auch infrage gestellt werden. Der Beitrag religionswissenschaftlicher Geschlechterforschung basiert dabei auf der Annahme, dass mit Religionen nicht nur Symbolsysteme, Weltanschauungen oder Lebensformen vorliegen, sondern mit anderen gesellschaftlichen Institutionen eng verwobene soziale Felder, in denen gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht, Körper und Sexualität erzeugt, reproduziert und verhandelt werden.
Der Einfluss gendertheoretischer Perspektiven auf die Religionswissenschaft wurde seit den 1970er-Jahren ausgehend von der feministischen Kritik am Androzentrismus der religionswissenschaftlichen Disziplin sichtbar. Denn auch religionswissenschaftliche Fragestellungen, Begriffe und Theorien – bis hin zu den Forschenden selbst – waren stark von männlich geprägten Normvorstellungen bestimmt. Die Notwendigkeit wurde deutlich, die theoretischen Grundannahmen der Religionswissenschaft selbst zu hinterfragen und offenzulegen, wie Geschlecht, Körper und Sexualität sowohl in religiösen Diskursen als auch in der Forschung selbst als machtvolle Kategorien wirksam sind. In den 1990er-Jahren und darüber hinaus konnten diese Ansätze mit queer-theoretischen und postkolonialen Perspektiven weiter vertieft werden. Es wurde gezeigt, dass nicht nur binäre Geschlechterkonzepte, sondern auch eurozentrische und heteronormative Macht- und Wissensordnungen kritisch zu befragen sind. So richtet sich religionswissenschaftliche Geschlechterforschung mittlerweile interdisziplinär aus: Sie greift feministische Theorien auf, nimmt queer- und transtheoretische, intersektionale und post-koloniale Perspektiven ein und bedient sich soziologischer und kulturhistorischer Ansätze. Indem sie Religion als dynamisches Feld von Aushandlungsprozessen versteht, in welchem sich soziale Differenzen, Machtverhältnisse und symbolische Ordnungen verdichten, trägt sie zur Dekonstruktion vermeintlich „natürlicher“ Ordnungen bei und eröffnet neue Perspektiven auf die wechselseitige Konstitution von Religion und Geschlecht.
Die Beiträge der Ergänzungslieferung geben in unterschiedlicher Art und Weise einen Einblick in die bis dato erreichte historische, methodische und theoretische Breite in der religionswissenschaftlichen Geschlechterforschung:
Benedikt Bauer, z.Zt. Incoming Senior Fellow des Elisabeth-List-Fellowship-Programms in Graz, und Kristina Göthling-Zimpel, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an der Universität Hamburg, thematisieren die Institutionalisierung von Genderforschung innerhalb der Religionswissenschaft. Im engeren Fokus steht der Arbeitskreis Gender und Religion (AKGR) der Deutschen Vereinigung für Religionswissenschaft (DVRW), seine Entstehung, Aktivitäten und Ausrichtung. Es wird dessen Rolle als zentrale Plattform für religionsbezogene Genderforschung im deutschsprachigen Raum aufgezeigt.
Verena Hoberg, stellvertretende Geschäftsführerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Organisation Public Health Schweiz, untersucht den Möglichkeitsraum leiblicher Erfahrung im evangelikalen Christentum. Die zunächst so eindeutig erscheinende evangelikale Geschlechterordnung zeigt sich dabei nicht ohne Widersprüche, Unbestimmtheiten und Räume für Ambiguitäten und Umdeutungen. Diese Dynamik wird in der Außenwahrnehmung wie in der Repräsentanz kaum sichtbar, da der Evangelikalismus sich über bestimmte antimoderne Identifikationsmarker präsentiert und andere Positionen erfolgreich außerhalb dieses Evangelikalismus stellt.
Marita Günther, Doktorandin an der Philipps Universität Marburg und Lehrbeauftragte, beleuchtet in ihrem Beitrag über zeitgenössische feministische Spiritualitäten deren aktuelle Entwicklungen und Dynamiken. Der Beitrag gibt Einblicke in Forschungsstand und Begriffsdiskussionen, geht auf zentrale Aspekte feministischer Spiritualitäten ein und stellt Beispiele aus dem Bereich der digitalen Medien, geschlechterspezifischer Körperlichkeiten und matriarchatsfeministischer Spiritualität vor. Der Beitrag plädiert angesichts der Heterogenität des Feldes für einen kontextkritischen Pluralbegriff der Spiritualitäten und zeigt offene Arbeitsfelder auf.
Doris Decker, Professorin an der Universität Zürich, legt in ihrem Beitrag die Konstruktions- und Zuschreibungsprozesse offen, die in Texten über den Beginn des Islam Geschlechterkonzeptionen hervorgebracht haben. Auf dieser Basis spricht sie sich dafür aus, aus religionsgeschichtlichen Textquellen abgeleitete normative Ordnungen kritisch zu betrachten und interpretative Absolutheitsansprüche bzgl. Geschichte, Gesellschaft, Geschlecht u.a. in Frage zu stellen. Zudem empfiehlt sie Religionswissenschaftler*innen, sich nicht an weiteren Geschichtsrekonstruktion zu beteiligen, sondern vielmehr besagte Konstruktions- und Zuschreibungsprozesse, die Ordnungen einführen, begründen und festigen wollen, aufzudecken.
Paulina Rinne, Doktorandin der Religionswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg, beleuchtet am Beispiel von Annemarie Schimmel die Marginalisierung von Wissenschaftlerinnen in der Religionswissenschaft und damit verbundene komplexe Machtdynamiken. Indem sie aufzeigt, wie die breite Expertise von Annemarie Schimmel auf eine öffentliche Kontroverse reduziert wurde, unterstreicht sie die Dringlichkeit einer – von ihr damit geforderten – gendersensiblen Fachgeschichte, die androzentrische Machtstrukturen und Selektivität/“selektive Erinnerungskultur“ kritisch hinterfragt.
Jessica A. Albrecht, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie und Research Fellow im Projekt „Alternative Rationalities and Esoteric Practices from a Global Perspective“ (CAS-E) an der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, macht in ihrem Beitrag darauf aufmerksam, wie die Religionswissenschaft als Bindeglied zwischen postkolonialen Theorien und Queer-Theorie fungieren kann. Dabei weist sie mittels einer Untersuchung der Kolonialität von Geschlecht und Fallstudien nach, wie queer- und postkoloniale Theorien den Gegenstand, die Forschung und die Lehre innerhalb der Religionswissenschaft beeinflussen, und plädiert für ein differenziertes Verständnis von Verkörperung und ihrer Verstrickung in Machtverhältnisse.
Verena Maske, Doktorandin an der Philipps-Universtität Marburg und Lehrkraft an einer Fachschule für Sozialpädagogik in Hannover, thematisiert auf Grundlage ethnographischer Feldforschung den Umgang mit Körper, Geschlecht und Sexualität in der islamischen Jugendkultur des Pop-Islam im deutschsprachigen Raum und versteht diese als identitätspolitische Positionierung sowohl gegenüber der Mehrheitsgesellschaft als auch innerhalb des Islam. Besonderes Augenmerk liegt auf jungen weiblichen Körpern als zentralen Orten, an denen Geschlechterrollen und Sexualitätsnormen ausgehandelt und für religiöse Distinktionsprozesse mobilisiert werden. Die Beleuchtung von emanzipatorischen Spielräumen und normierenden Begrenzungen sowie der systematische Einbezug der Jugend als Lebensphase bieten eine exemplarische Grundlage für theoretische Einordnungen und Überlegungen sowie die Benennung von Forschungsdesideraten im Bereich religionswissenschaftlicher Geschlechterforschung.
In dem die Ergänzungslieferung abschließenden Beitrag vertreten Verena Maske, Marita Günther und Doris Decker die These, dass Körper und Sexualität im Zentrum gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse um Ordnung, Kontrolle und Macht stehen und daher in einer Analyse des Verhältnisses von Religion und Geschlecht als Kategorien einbezogen werden sollten. Um ihre These zu entfalten, geben sie Einblicke in den Forschungsstand, zeigen aktuelle Themenfelder und Desiderate einer religionswissenschaftlichen Geschlechterforschung auf und diskutieren den elementaren Stellenwert dieses Forschungsansatzes u.a. für die Fachdisziplin, bevor sie mit den für sich daraus ergebenden Forschungsperspektiven und Postulate schließen. Die Autorinnen sprechen sich dafür aus, dass gerade eine zu den Interdependenzen der im Fokus stehenden Kategorien arbeitende gendertheoretische Religionswissenschaft wichtige Perspektiven in Bezug auf aktuelle gesellschaftspolitische Entwicklungen – wie zunehmende religiös konservative, antifeministische und antigenderistische sowie antidemokratische Bewegungen – einnehmen kann.
Anhand dieser Beiträge, die einen Einblick in die Vielfalt religionswissenschaftlicher Geschlechterforschung geben, soll zudem gezeigt – sowie dafür plädiert – werden, dass es sich hierbei um eine grundlegende, unverzichtbare Perspektive für die Analyse von Religion in Geschichte und Gegenwart und nicht nur um eine Ergänzung der etablierten Disziplin handelt. Denn eine gendertheoretische Perspektive in der Religionswissenschaft vermag es, ein Verstehen religiöser Traditionen, Praktiken und Diskurse zu fördern und Fragen an deren disziplinäres Selbstverständnis aufzuwerfen: Wie werden Kategorien wie Religion, Geschlecht, Sexualität und Körper im wissenschaftlichen Diskurs gebildet? Welche Macht- und Ausschlussmechanismen prägen diese Wissensordnungen? Und wie können interdisziplinäre Ansätze dazu beitragen, die Religionswissenschaft als eine reflexive, selbstkritische Wissenschaft weiterzuentwickeln?
Wir danken allen Autor*innen für ihre wertvollen Beiträge sowie den Herausgebern und der Redaktion des Handbuchs der Religionen für ihre Unterstützung.
Doris Decker, Marita Günther und Verena Maske
(die Facheditorinnen)